Mit einem wegweisenden Hinweisbeschluss vom 22. März 2024 (Az. I ZR 88/23) hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein starkes Signal im Glücksspielrecht gesetzt: Spieler können ihre Verluste aus illegalem Online-Glücksspiel und unerlaubten Online-Sportwetten zurückfordern. Im Kern geht es um die Frage, ob Verträge mit Anbietern ohne gültige deutsche Glücksspiellizenz automatisch nichtig sind – eine Rechtsfrage, die bislang in Rechtsprechung und Fachliteratur umstritten war. Das BGH-Urteil stellt klar: Ein solcher Vertrag verstößt gegen den Glücksspielstaatsvertrag 2012 (GlüStV 2012) sowie gegen § 134 BGB und ist damit unwirksam. Besonders relevant für Betroffene: Selbst eine EU-Lizenz aus Malta oder Gibraltar schützt Anbieter nicht, wenn sie gezielt den deutschen Markt bedienen. Das BGH-Urteil schafft eine starke Grundlage für Rückforderungsansprüche und könnte tausenden Spielern, die in den letzten Jahren hohe Verluste bei Online-Glücksspielen erlitten haben, den Weg zu einer Rückerstattung ebnen.
Fall Betano: BGH-Urteil bestätigt Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Ausgangssituation – Betano und Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Die in Österreich ansässige Betkick Sportwettenservice GmbH, bekannt unter der Marke „Betano“, bot zwischen Oktober und Dezember 2018 Sportwetten im Internet in Deutschland an. Der Kläger nahm in diesem Zeitraum am Angebot teil und erlitt einen Verlust von knapp 12.000 Euro. Zu diesem Zeitpunkt verfügte „Betano“ nicht über eine gültige deutsche Glücksspiellizenz, obwohl ein entsprechender Antrag bereits gestellt war. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte 2016 die zuständige Behörde verpflichtet, die Lizenz zu erteilen – dennoch war das Verfahren bis Ende 2018 nicht abgeschlossen. Erst im Jahr 2021 erhielt das Unternehmen die erforderliche Genehmigung. Der Fall ist exemplarisch für zahlreiche Klagen gegen nicht lizenzierte Anbieter von Online-Glücksspiel und verdeutlicht die Bedeutung der deutschen Lizenzpflicht für den Verbraucherschutz, gerade bei grenzüberschreitenden Angeboten im Internet.
Entscheidung in erster Instanz – Landgericht München zu § 134 BGB und Rückforderung von Verlusten bei Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Das Landgericht München wies die Klage zum Online-Glücksspiel ohne Lizenz zunächst ab. Die Richter argumentierten, dass das bloße Fehlen einer erteilten Lizenz beim Online-Glücksspiel nicht automatisch zur Nichtigkeit der Verträge führe, sofern der Anbieter grundsätzlich erlaubnisfähig sei. Man stellte darauf ab, dass ein Konzessionsantrag vorlag und die Erteilung der Lizenz lediglich zeitlich verzögert wurde. Nach Ansicht des LG könne eine solche Verzögerung nicht ohne weiteres den Rückforderungsanspruch bei illegalem Online-Glücksspiel begründen. Diese Sichtweise steht für eine restriktive Auslegung des § 134 BGB, die vor allem in der Literatur, aber auch in Teilen der Rechtsprechung vertreten wird. Sie berücksichtigt primär die formale Erlaubnisfähigkeit und weniger den materiellen Schutzzweck der Norm.
Entscheidung in zweiter Instanz – Oberlandesgericht München: Rückzahlung der Einsätze bei illegalem Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Das Oberlandesgericht München kam in der Berufung zu einer gegenteiligen Auffassung: Ohne gültige deutsche Lizenz seien die Wettverträge nichtig (§ 134 BGB). Der Kläger habe nach § 812 BGB Anspruch auf Rückzahlung seiner Einsätze bei dem illegalem Online-Glücksspiel, da kein rechtlicher Grund für die Leistung aufgrund der fehlenden Lizenz bestanden habe. Das Gericht betonte, dass die Lizenzpflicht eine zentrale Markt- und Verbraucherschutzfunktion im Online-Glücksspiel erfüllt und Verstöße nicht lediglich als formale Mängel anzusehen sind. Die Richter stellten zudem klar, dass das Angebot im relevanten Zeitraum nicht erlaubnisfähig war, da keine gültige Lizenz vorlag und die erforderlichen Genehmigungsvoraussetzungen für Online-Glücksspiele gemäß dem Glücksspielstaatsvertrag 2012 nicht erfüllt waren.
BGH-Urteil – Spielerschutz und Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Das BGH-Urteil zur Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz bestätigte in einem Hinweisbeschluss diese Rechtsauffassung und betonte, dass die Lizenzpflicht nicht nur der Marktordnung, sondern vor allem dem Schutz der Spieler diene. Der Schutzzweck bestehe darin, Verbraucher vor erheblichen finanziellen Risiken und Spielsucht zu bewahren. Angesichts dieser klaren Position zog „Betano“ die Revision zurück – das Urteil des OLG München wurde rechtskräftig. Dieser Schritt zeigt, dass die Beklagte wohl keine realistische Chance sah, die Entscheidung zu ihren Gunsten zu verändern. Der Beschluss des BGH wird inzwischen von anderen Oberlandesgerichten als Orientierung herangezogen und gilt als klares Signal, dass die deutsche Rechtsprechung Rückforderungsansprüche aus Online-Glücksspiel ohne Lizenz konsequent stützt.
Rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen für Rückforderung von Online-Glücksspielverlusten nach § 134 BGB & GlüStV 2012
Die rechtliche Basis für Rückzahlungsansprüche aus Online-Glücksspielen ohne Lizenz bildet in erster Linie das Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB). Nach der aktuellen BGH-Rechtsprechung sind Verträge mit Anbietern ohne gültige deutsche Lizenz gemäß § 134 BGB nichtig, da sie gegen das gesetzliche Verbot des § 4 GlüStV 2012 verstoßen. Die Folge: Der Spieler kann seine geleisteten Einsätze zurückfordern. Dabei gilt jedoch eine wichtige Einschränkung: Der Anspruch entfällt, wenn der Anbieter nachweisen kann, dass der Spieler bewusst und vorsätzlich an illegalem Online-Glücksspiel teilgenommen hat (§ 817 Satz 2 BGB). Die Beweislast für diesen Vorsatz liegt beim Anbieter – in der Praxis ist dieser Nachweis oft schwierig zu erbringen.
Ebenfalls relevant ist die Verjährung: In der Regel beträgt sie drei Jahre ab Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände (§ 195 BGB). Wird der Anspruch zusätzlich auf eine unerlaubte Handlung (§ 823 Abs. 2 BGB i. V. m. GlüStV) gestützt, kann die Frist bis zu zehn Jahre betragen (§ 852 BGB).
Wichtige Eckpunkte zur Rückforderung aus Online-Glücksspielen ohne Lizenz:
- Vertrag ohne deutsche Lizenz = nichtig (§ 134 BGB, GlüStV 2012)
- Keine Rückforderung aus Online-Glücksspielen bei nachweislich vorsätzlicher Teilnahme (§ 817 S. 2 BGB)
- Beweislast für Vorsatz liegt beim Anbieter (Spielerschutz)
- Verjährungsfristen: 3 oder 10 Jahre (je nach Anspruchsgrundlage)
Abweichende Rechtsmeinungen zum BGH-Urteil zur Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Obwohl die BGH-Linie derzeit maßgeblich ist, existieren in Literatur und unterinstanzlicher Rechtsprechung abweichende Auffassungen. Einige Gerichte vertreten die Ansicht, dass das bloße Fehlen einer erteilten Lizenz nicht automatisch zur Nichtigkeit des Vertrages im Online-Glücksspiel führen müsse, sofern der Anbieter grundsätzlich erlaubnisfähig war und lediglich das Verwaltungsverfahren verzögert wurde. Diese Sichtweise versteht § 134 BGB eher als Marktordnungsnorm, die primär den Wettbewerb strukturiert, nicht als zwingendes Instrument zum individuellen Vermögensschutz.
Andere Stimmen plädieren dafür, § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. dem GlüStV als „Schutzgesetz“ zu qualifizieren. Das hätte den Vorteil einer verlängerten Verjährung und einer zusätzlichen Anspruchsgrundlage, würde jedoch den Anwendungsbereich erheblich erweitern. Kritiker warnen vor einer Überdehnung, die zu einer Flut von Klagen führen könnte, auch in Fällen, in denen der Anbieter des Online-Glücksspiel faktisch genehmigungsfähig war und eine Lizenz erhalten konnte.
Kerndifferenz: BGH-Urteil vs. alternative Auffassungen zur Nichtigkeit von Online-Glücksspielen ohne Lizenz
BGH-Urteil:
- Fehlende deutsche Lizenz = zwingende Nichtigkeit des Vertrages (§ 134 BGB, GlüStV 2012)
- Primärer Zweck: Verbraucherschutz vor finanziellen und gesundheitlichen Risiken
- Rückforderung über § 812 BGB, Verjährung in der Regel 3 Jahre
Alternative Auffassungen:
- Lizenzmangel nicht zwingend gleich Vertragsnichtigkeit, wenn Erlaubnisfähigkeit gegeben
- Fokus auf Marktordnung, nicht zwingend individueller Vermögensschutz
- Rückforderung ggf. über § 823 Abs. 2 BGB (Schutzgesetz) → 10-jährige Verjährung ( 852 BGB)
Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass der Kernstreit nicht nur in der Auslegung des § 134 BGB liegt, sondern in der grundsätzlichen Frage, ob der Schutzzweck des Glücksspielrechts vorrangig die Marktstruktur oder den einzelnen Verbraucher betrifft. Die künftige EuGH-Entscheidung könnte hier eine klare Richtung vorgeben.
Bedeutung des BGH-Urteils für den Verbraucherschutz und Ausblick auf das EuGH Verfahren Tipico
Das BGH-Urteil unterstreicht, dass die Lizenzpflicht im Online-Glücksspiel nicht bloß eine Formalität ist, sondern ein zentrales Instrument des Spielerschutzes. Ziel ist es, Verbraucher vor den erheblichen finanziellen und gesundheitlichen Risiken des Glücksspiels zu bewahren. Gerade im Bereich des Internets, wo Anbieter oft grenzüberschreitend agieren, schafft die deutsche Lizenzpflicht eine klare rechtliche Grenze. Für Spieler bedeutet das: Wer in der Vergangenheit bei Anbietern von Online-Glücksspielen ohne gültige deutsche Lizenz Einsätze verloren hat, kann diese in vielen Fällen zurückfordern – oft in einer Größenordnung von fünf- bis sechsstelligen Beträgen.
Unionsrechtliche Dimension – EuGH Verfahren Tipico und Auswirkungen auf Rückforderung aus Online-Glücksspielen ohne Lizenz
Parallel zu den nationalen Entscheidungen hat der BGH am 25. Juli 2024 im Verfahren C-530/24 (Tipico Co. Ltd.) den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um eine Vorabentscheidung gebeten. Bei Tipico handelt es sich um einen der bekanntesten Sportwettenanbieter Europas, mit Sitz auf Malta und einer dort erteilten Lizenz. Der Fall weist Parallelen zu „Betano“ auf: Auch hier hatte der Anbieter in Deutschland Sportwetten angeboten, ohne im fraglichen Zeitraum über eine gültige deutsche Glücksspiellizenz zu verfügen.
Der EuGH soll nun klären, ob das deutsche Lizenzsystem – insbesondere die strenge nationale Erlaubnispflicht – mit der europäischen Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV vereinbar ist. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob das deutsche Lizenzverfahren unionsrechtskonform ausgestaltet war oder ob es Anbieter aus anderen EU-Mitgliedstaaten faktisch benachteiligt. Das Verfahren ist von erheblicher Tragweite, da eine Feststellung der Unionsrechtswidrigkeit nicht nur zukünftige Genehmigungsverfahren verändern, sondern auch bestehende Rückforderungsansprüche beeinflussen könnte.
Die mündliche Verhandlung vor dem EuGH ist für den 24. September 2025 angesetzt. Je nach Ausgang könnte das Urteil entweder die Linie des BGH stützen und Rückforderungen erleichtern – oder den Anbietern eine Argumentationsgrundlage liefern, um sich gegen Rückzahlungen aus Online-Glücksspielen ohne Lizenz zu wehren, wenn das nationale Verfahren als EU-rechtswidrig eingestuft wird.
Mögliche Auswirkungen einer EuGH-Entscheidung auf die Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz:
- Bestätigung der deutschen Lizenzpflicht → Stärkung der Rückforderungsansprüche
- Einschränkung der Lizenzpflicht wegen Unionsrechtsverstoß → mögliche Begrenzung von Ansprüchen
- Mehr Rechtssicherheit für Verbraucher und Anbieter
Bis zur EuGH-Entscheidung bleibt die aktuelle BGH-Linie maßgeblich – mit einer klaren Tendenz zugunsten des Verbraucherschutzes und gegen Anbieter ohne deutsche Lizenz.
Strategische Bedeutung und Handlungsempfehlungen für die Rückforderung von Online-Glücksspielverlusten
Für Spieler eröffnet die gefestigte Rechtsprechung des BGH eine erhebliche Chance die Rückzahlung von Glücksspielverlusten zu verlangen. Wer zwischenzeitlich bei Anbietern von Online-Glücksspielen ohne gültige deutsche Lizenz gespielt und dabei Verluste erlitten hat, sollte seine Ansprüche zeitnah prüfen lassen – insbesondere unter Berücksichtigung der Verjährungsfristen. Dabei empfiehlt sich eine strukturierte Vorgehensweise, um die Erfolgsaussichten zu maximieren.
Empfohlene Schritte zur Anspruchsdurchsetzung bei Verlusten aus Online-Glücksspiel ohne Lizenz:
- Vertrags- und Transaktionsdaten sichern: Kontoauszüge, Spielverläufe und Kommunikationsprotokolle aufbewahren
- Lizenzstatus prüfen: Klären, ob der Anbieter im relevanten Zeitraum eine gültige deutsche Glücksspiellizenz hatte
- Rechtsberatung einholen: Anwälte für Verbraucherrecht können die Erfolgschancen einschätzen und die Rückforderung durchsetzen.
- Verjährungsfristen beachten: Rechtzeitig handeln, um Ansprüche nicht zu verlieren (3 Jahre / 10 Jahre je nach Anspruchsgrundlage).
Für Anbieter ohne deutsche Lizenz erhöht sich der wirtschaftliche Druck erheblich. Neben den Rückzahlungsrisiken von Glücksspielverlusten drohen auch Reputationsschäden und potenzielle straf- oder verwaltungsrechtliche Konsequenzen. Die BGH-Entscheidung und die daraus resultierenden Präzedenzfälle setzen neue Maßstäbe für die Branche – mit Signalwirkung auch über die Glücksspielbranche hinaus. Unternehmen, die in Deutschland tätig werden wollen, sind gut beraten, vor Markteintritt sämtliche regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, um rechtliche und wirtschaftliche Risiken zu minimieren.
Unsere Anwälte für Datenschutz- und IT-Recht unterstützen Sie bei der rechtssicheren Gestaltung Ihrer Online-Angebote!
Fazit – BGH-Urteil beeinflusst Rückerstattung von Verlusten aus Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Der Fall „Betano“ markiert einen Wendepunkt im deutschen Glücksspielrecht. Mit der Bestätigung, dass Verträge mit nicht lizenzierten Anbietern nach § 134 BGB nichtig sind, hat der BGH nicht nur den Verbraucherschutz gestärkt, sondern auch eine klare Warnung an die Glücksspielbranche ausgesprochen. Für betroffene Spieler bedeutet dies: Die Chancen auf Rückzahlung von Glücksspielverlusten aus Online-Glücksspielen stehen so gut wie nie zuvor – vorausgesetzt, sie handeln rechtzeitig und können ihre Teilnahme belegen. Das Verfahren hat zugleich gezeigt, dass der deutsche Gesetzgeber mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2012 ein wirksames Schutzinstrument geschaffen hat, das auch in der digitalen und grenzüberschreitenden Glücksspielwelt Bestand hat.
Mit Spannung blickt die Branche nun auf das im September 2025 erwartete Urteil des EuGH. Sollte der EuGH die deutsche Lizenzpflicht bestätigen, wäre dies eine endgültige Absicherung der aktuellen Rechtsprechung. Kommt es hingegen zu einer stärkeren Gewichtung der europäischen Dienstleistungsfreiheit, könnte sich die Rechtslage zugunsten der Anbieter verschieben. Bis dahin gilt: Wer als Spieler zwischenzeitlich bei nicht lizenzierten Anbietern Verluste erlitten hat, sollte die Gelegenheit nutzen, seine Ansprüche zu prüfen. Die BGH-Entscheidung hat den Weg geebnet – jetzt liegt es an den Betroffenen, diese Möglichkeit aktiv zu nutzen. Anbieter hingegen müssen sich auf eine strengere Regulierung, intensivere Rechtsdurchsetzung und eine zunehmend risikobehaftete Geschäftstätigkeit in Deutschland einstellen.
Verluste beim Online-Glücksspiel? Holen Sie sich Ihr Geld zurück!
Das BGH-Urteil eröffnet neue Chancen für Spieler. Unsere Anwälte helfen Ihnen, Ihre Ansprüche durchzusetzen
Jetzt Beratung sichern und mit Akte Online jederzeit über den Stand Ihres Rechtsfalls informiert werden!
❓ FAQ – BGH-Urteil: Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz
Das BGH-Urteil zur Nichtigkeit von Online-Glücksspiel besagt, dass Verträge mit Anbietern ohne deutsche Glücksspiellizenz nichtig sind und Verluste zurückgefordert werden können.
Je nach Einsatzverlauf können Ansprüche im fünf- bis sechsstelligen Bereich möglich sein laut dem BGH-Urteil zur Rückzahlung von Glücksspielverlusten.
Bei nachweislich vorsätzlicher Teilnahme kann der Rückforderungsanspruch entfallen (§ 817 Satz 2 BGB) laut dem BGH-Urteil zur Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz.
Prüfen Sie, ob eine gültige deutsche Glücksspiellizenz vorliegt. Diese wird von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder vergeben und ist im Impressum oder auf der Website einsehbar.
Weiterführende Themen

BGH-Urteil zu Vielfachabmahnern: Wann Abmahnungen rechtsmissbräuchlich sind
BGH-Urteil zu Vielfachabmahnern: Wann Abmahnungen rechtsmissbräuchlich sind – Onlinehändler und Juristen erhalten endlich klare Leitlinien zur rechtlichen Zulässigkeit von Massenabmahnungen. Erfahren Sie, worauf es jetzt bei Unterlassungserklärungen und Vertragsstrafen ankommt.

BGH-Urteil: Nichtigkeit von Online-Glücksspiel ohne Lizenz
BGH Urteil: Rückzahlung bei illegalem Glücksspiel möglich – Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechte von Spielern deutlich. Wer bei Anbietern ohne gültige deutsche Glücksspiellizenz Verluste erlitten hat, kann diese in vielen Fällen zurückfordern. Das Urteil schafft erstmals klare rechtliche Grundlagen und setzt ein starkes Signal für den Verbraucherschutz. Erfahren Sie, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, wie Sie Ihre Ansprüche durchsetzen und welche Fristen Sie unbedingt beachten sollten.
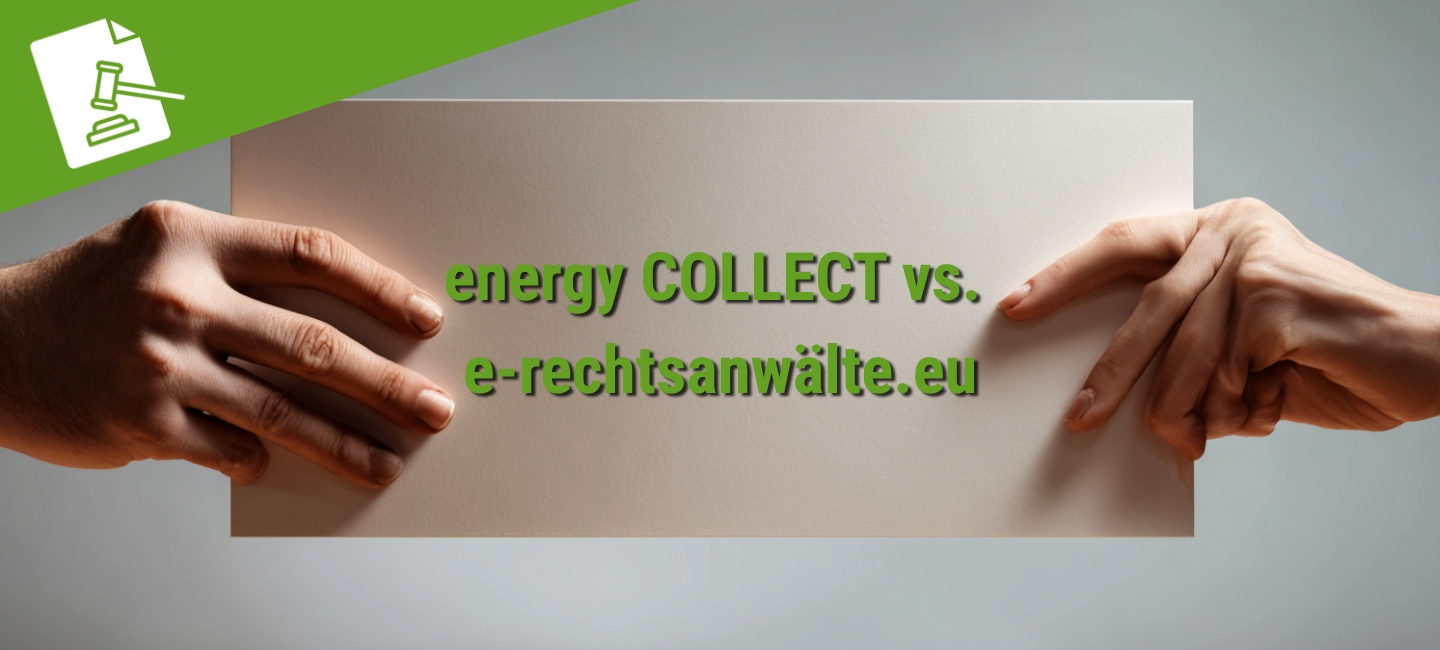
BGH-Urteil: e-rechtsanwälte.eu behält Domain
Im Rechtsstreit zwischen e-rechtsanwälte.eu und der energy COLLECT GmbH hat der BGH ein klares Signal gesetzt: Ältere Domains bleiben oft beim bisherigen Inhaber. Lesen Sie, welche Konsequenzen das Urteil für Marken, Unternehmen und Domainstrategien hat.